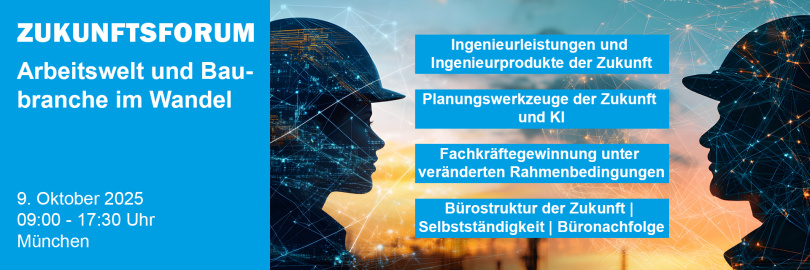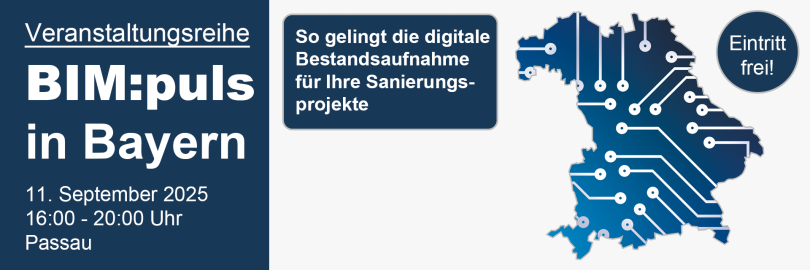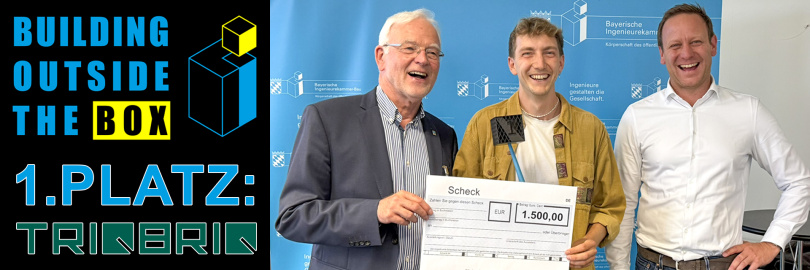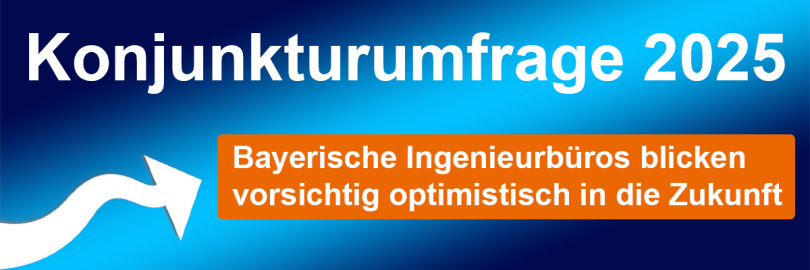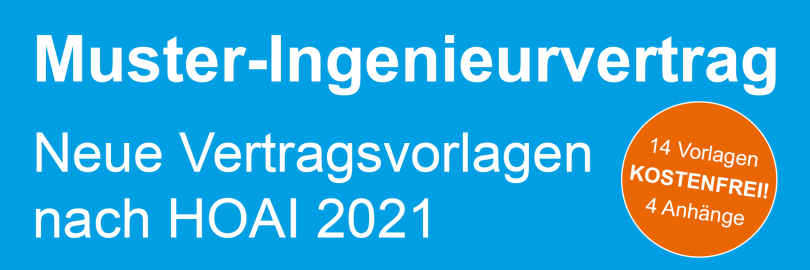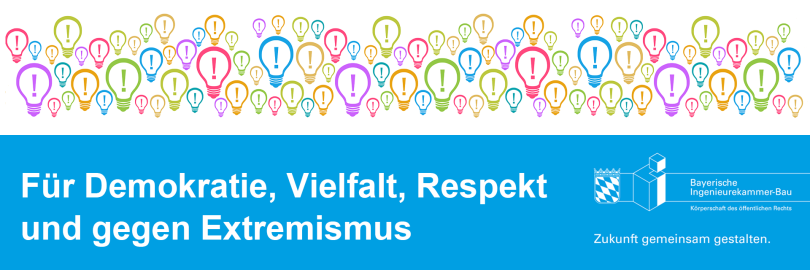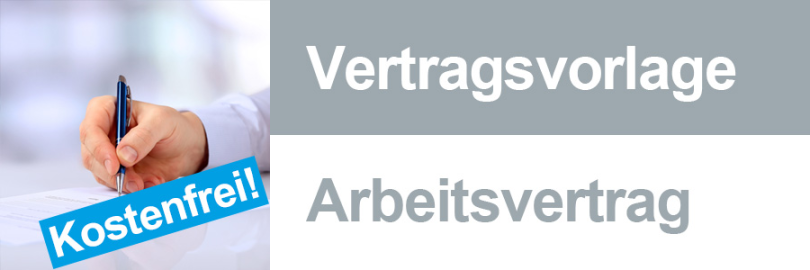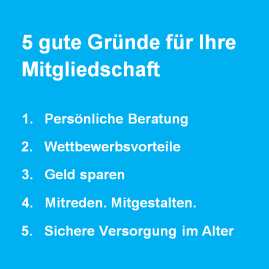Brückenplanung: Warum die Vorplanung über den Projekterfolg entscheidet
Neuer kostenfreier Leitfaden "Brückenplanung kompakt: Von der Idee bis zur Genehmigung"
22.07.2025 - Berlin

Die Planung von Brückenbauwerken folgt in Deutschland einem komplexen, stark regulierten Prozess, der von der Bedarfsplanung bis zur Bauausführung sieben wesentliche Phasen durchläuft. Während die rechtlichen Grundlagen durch die Richtlinien zum Planungsprozess (RE 2012) und die Regeln für die Aufstellung von Ingenieurbauwerksentwürfen (RAB-ING) klar definiert sind, bestätigt die Praxis immer wieder: Der Projekterfolg wird maßgeblich in den frühen Planungsphasen bestimmt, wie der neue kostenfreie Leitfaden "Brückenplanung kompakt: Von der Idee bis zur Genehmigung" zeigt.
Das Problem vorgegebener Randbedingungen
Nach § 24 der Bundeshaushaltsordnung dürfen öffentliche Auftraggeber Ausgaben für Baumaßnahmen erst dann veranschlagen, wenn genehmigte Pläne, Kostenberechnungen und ausführliche Entwurfszeichnungen vorliegen. Diese scheinbar technische Vorgabe hat weitreichende Konsequenzen für die Planungslogik: Jede nachträgliche Änderung löst aufwendige Genehmigungsverfahren aus und kann zu erheblichen Verzögerungen führen.
In der Bedarfsplanung werden bereits grundlegende Parameter wie Straßenkategorie, Anfangs- und Endpunkt sowie die grundsätzliche Trassenführung festgelegt. Für Brückenbauwerke bedeutet dies, dass wesentliche Randbedingungen – Kreuzungswinkel, Gradientenverlauf, erforderliche Lichtraumprofile – oft vorgegeben sind, bevor die eigentliche Brückenplanung beginnt.
Kritische Schnittstelle: Strecken- und Bauwerksplanung
Die Erfahrung zeigt, dass eine der häufigsten Ursachen für spätere Kostensteigerungen und Terminverzögerungen in der unzureichenden Abstimmung zwischen der Streckenplanung und der eigentlichen Bauwerksplanung liegt. Während die Streckenplaner primär verkehrliche und trassierungstechnische Aspekte optimieren, haben deren Entscheidungen direkten Einfluss auf die Komplexität und Wirtschaftlichkeit der Brückenkonstruktion.
Typische Konfliktpunkte entstehen bei:
- Großräumigen Trassenführungen mit extremen Krümmungsradien oder Längsneigun
- gen Kreuzungswinkeln, die zu aufwendigen Schrägbrücken führen
- Zwangspunkten durch bestehende Infrastruktur oder Umweltauflagen
- Querschnittsaufweitungen für Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen im Brückenbereich
Die frühzeitige Einbindung von Brückenplanern in die Streckenplanung kann hier erhebliche Optimierungsmöglichkeiten eröffnen. Bereits kleine Anpassungen der Gradiente oder der Linienführung können die Brückenabmessungen reduzieren oder die Anzahl der erforderlichen Stützweiten begrenzen.
Variantenbewertung: Zwischen Technik, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungsfähigkeit
Die Entwicklung und Bewertung von Brückenvarianten erfordert eine systematische Herangehensweise, die über reine Kostenvergleiche hinausgeht. Erfahrene Planer berücksichtigen dabei mindestens fünf wesentliche Bewertungskriterien:
- Tragwerksaspekte umfassen die Zuverlässigkeit des statischen Systems, die Auswirkungen von Schiefe, Krümmung und besonderen Stützweitenverhältnissen sowie die Robustheit der gewählten Konstruktion. Besonders bei Ersatzneubauten spielen die Möglichkeiten der Verkehrsführung während der Bauzeit eine entscheidende Rolle.
- Baurecht und Baudurchführung werden oft unterschätzt, obwohl sie maßgeblich über die Realisierbarkeit entscheiden. Die Verfügbarkeit von Flächen für Baustelleneinrichtung, die Genehmigungsfähigkeit des gewählten Bauverfahrens und die Minimierung von Umweltbeeinträchtigungen während der Bauzeit können ausschlaggebend sein.
- Wirtschaftliche Bewertung beschränkt sich nicht auf die reinen Herstellungskosten, sondern muss Baubehelfe, mögliche Verkehrsbehinderungen und Folgekosten über die gesamte Nutzungsdauer einbeziehen. Hier zeigt sich oft, dass vermeintlich günstige Varianten bei ganzheitlicher Betrachtung unwirtschaftlich werden.
- Gestaltungsaspekte gewinnen insbesondere bei exponierten Brückenstandorten an Bedeutung. Die Integration in das Landschafts- oder Stadtbild, die Maßstäblichkeit zur Umgebung und die Klarheit der Tragwerksstruktur beeinflussen nicht nur die öffentliche Akzeptanz, sondern können auch genehmigungsrelevant werden.
- Prüfung und Erhaltung werden in der Planungsphase oft vernachlässigt, obwohl sie die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Nutzungsdauer bestimmen. Die Zugänglichkeit aller prüfrelevanten Bauteile, die Verwendung wartungsarmer Materialien und die Möglichkeit späterer Instandsetzungsmaßnahmen sollten bereits in der Entwurfsphase mitgedacht werden.
Kostenermittlung: Mehr als nur Quadratmeterpreise
Die Kostenschätzung für Brückenbauwerke folgt in Deutschland den Vorgaben der Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen (AKVS). Die dort aufgeführten Richtwerte bieten einen ersten Orientierungsrahmen, ersetzen aber nicht die projektspezifische Bewertung.
Aktuelle Submissionsergebnisse zeigen teilweise erhebliche Abweichungen von den Tabellenwerten der Regeln für Entwurf, Baudurchführung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken (REBI-ING). Regional unterschiedliche Marktbedingungen, die Verfügbarkeit spezialisierter Nachunternehmer und projektspezifische Risiken können zu Kostensteigerungen von 30 bis 50 Prozent gegenüber den Richtwerten führen.
Besonders bei Ersatzneubauten kommen zusätzliche Kostenfaktoren hinzu: Abbruchkosten der Bestandsbrücke (250-500 EUR/m² je nach Größe), Kosten für Verkehrsumlegungen und temporäre Bauwerke sowie mögliche Kontaminationsbeseitigung im Bestand.
Ersatzneubauten mit besonderen Herausforderungen
Ersatzneubauten machen inzwischen den Großteil der Brückenprojekte in Deutschland aus und stellen besondere Anforderungen an die Planungsmethodik. Anders als bei Neubauprojekten sind die räumlichen Zwangspunkte meist vorgegeben, gleichzeitig müssen moderne Anforderungen an Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit und Gestaltung erfüllt werden.
Die Verkehrsführung während der Bauzeit wird zum zentralen Planungsparameter. Bei zweiteiligen Brücken kann eine 4+0-Verkehrsführung auf einem Überbau erfolgen, was aber eine Nachrechnung und möglicherweise eine Verstärkung des verbleibenden Tragwerks erfordert. Einteilige Brücken erfordern entweder Vollsperrungen mit entsprechenden Umleitungen oder den Bau von Behelfsbrücken.
Die wirtschaftliche Bewertung verschiedener Bauvarianten muss dabei die gesamtgesellschaftlichen Kosten von Verkehrsbehinderungen einbeziehen. Längere Bauzeiten mit geringeren Verkehrsbeeinträchtigungen können gegenüber schnellen Lösungen mit Vollsperrungen durchauswirtschaftlicher sein.
Genehmigungsverfahren: Planungssicherheit durch systematisches Vorgehen
Die Planfeststellung für Brückenbauwerke erfordert umfangreiche Vorarbeiten, die weit über die rein technische Planung hinausgehen. Umweltverträglichkeitsprüfung, landschaftspflegerische Begleitplanung, Artenschutzbeiträge und Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Verträglichkeitsprüfungen müssen frühzeitig eingeleitet und koordiniert werden.
Erfahrungen zeigen, dass eine systematische Vorbereitung der Planfeststellungsunterlagen erheblich zur Verfahrensbeschleunigung beitragen kann. Die frühzeitige Einbindung aller betroffenen Träger öffentlicher Belange, die vollständige Aufbereitung aller erforderlichen Gutachten und die schlüssige Darstellung der Eingriffsminimierung und Kompensationsmaßnahmen reduzieren das Risiko von Nachforderungen und Verfahrensverzögerungen.
Qualitätssicherung: Das Vier-Augen-Prinzip bei Bauwerksentwürfen
Die Aufstellung und Prüfung von Bauwerksentwürfen folgt einem mehrstufigen Qualitätssicherungssystem. Der Entwurfsverfasser übernimmt mit dem Vermerk "Aufgestellt" die Verantwortung für Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die anschließende Prüfung durch eine fachlich qualifizierte Stelle und der „Gesehen“-Vermerk durch das Bundesverkehrsministerium (BMVI) stellen sicher, dass alle rechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind.
Bei Bauwerken mit veranschlagten Gesamtkosten ab drei Millionen Euro sind zusätzlich Entwurfsbesprechungen mit dem Bauherrn vorgesehen. Diese dienen nicht nur der fachlichen Abstimmung, sondern auch der Risikominimierung und der Sicherstellung, dass das geplante Bauwerk den verkehrspolitischen Zielsetzungen entspricht.
Fazit: Systematik als Erfolgsfaktor
Die erfolgreiche Planung von Brückenbauwerken erfordert ein systematisches Vorgehen, das bereits in den frühen Planungsphasen alle relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen, die Vielzahl der zu koordinierenden Fachdisziplinen und die wirtschaftlichen Anforderungen machen eine strukturierte Herangehensweise unerlässlich.
Besonders kritisch ist dabei die enge Verzahnung zwischen Strecken- und Bauwerksplanung sowie die frühzeitige Berücksichtigung aller genehmigungsrelevanten Aspekte. Eine systematische Variantenbewertung nach objektiven Kriterien kann dazu beitragen, die optimale Balance zwischen technischer Funktionalität, wirtschaftlicher Vertretbarkeit und gestalterischer Qualität zu finden.
PDF-Download: Kostenfreier Kompaktleitfaden "Brückenplanung"
Für die praktische Umsetzung dieser systematischen Herangehensweise wurden die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Standardwerk "Leitfaden Straßenbrücken" von Christoph Schmitz und Karlheinz Haveresch in einem kompakten Praxisleitfaden zusammengefasst.
Der kostenfreie Leitfaden "Brückenplanung kompakt: Von der Idee bis zur Genehmigung" enthält die erforderlichen Checklisten, Bewertungsmatrizen und Kalkulationshilfen für die systematische Anwendung der beschriebenen Planungsmethodik.
Die Kostenschätztabellen des Leitfadens basieren auf den aktuellen REBI-ING Richtwerten und berücksichtigen die dort genannten Hinweise zu regionalen Marktunterschieden. Besonders wertvoll sind die strukturierten Wertungstabellen für Neubau- und Ersatzneubau-Varianten, die eine objektive Bewertung nach den fünf wesentlichen Kriterien ermöglichen.
Der Leitfaden bietet:
- Übersichtliche Darstellung aller sieben Planungsphasen mit den jeweiligen Verfahren
- Kostenschätztabellen nach REBI-ING für verschiedene Brückentypen und -größen
- Systematische Wertungstabellen für Neubau- und Ersatzneubau-Varianten
- Drei konkrete Praxistipps zur Optimierung der Planungseffizienz
- Gestaltungsprinzipien für die architektonische Integration
Quellen: bauingenieur24, Ernst & Sohn GmbH, Grafik: Ernst & Sohn GmbH
Beitrag weiterempfehlen
Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).
Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats
Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Digitaltouren - Digitalforen

Netzwerk junge Ingenieur:innen

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de
Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung
Professional recognition

Anschrift
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Schloßschmidstraße 3
80639 München